Una Voce Korrespondenz — 1. Ausgabe 2024
6. Mai 2024
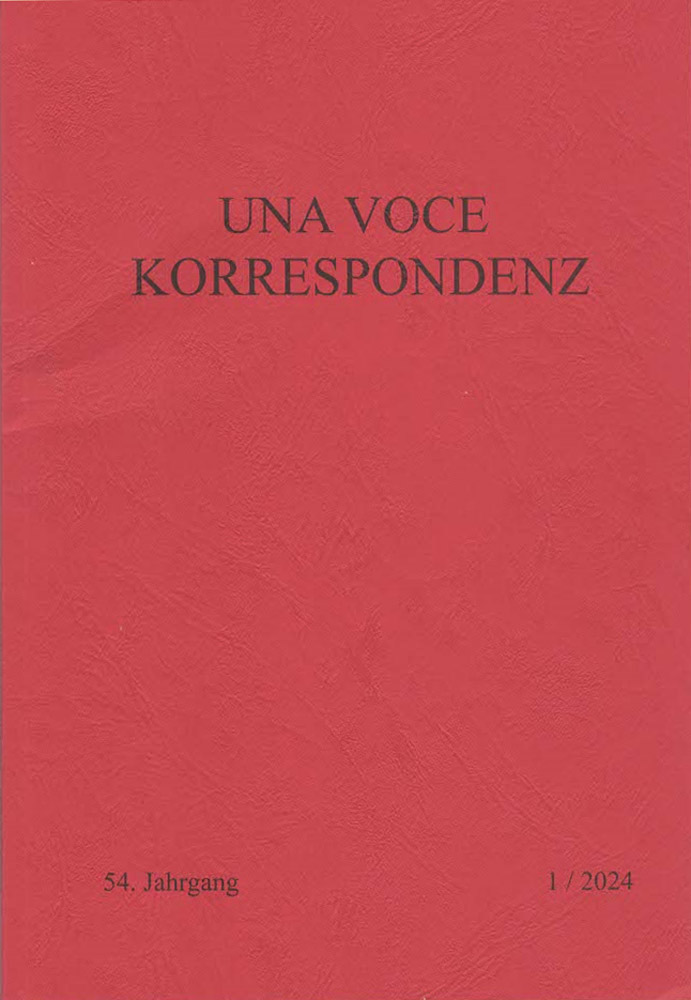
Die UVK geht in den 54. Jahrgang.
Seit Tagen schon liegt die neueste Ausgabe der UVK auf dem Schreibtisch und verlangt gebieterisch nach einer kurzen Vorstellung hier auf Summorum-Pontificum. Gebieterisch? Trotz Internet mit Blogs und Kurznachrichten; alles aktuell und tagesfrisch? Ja – vielleicht sogar wegen. Die Netzmedien haben die Art, wie die meisten Menschen Informationen aufnehmen, tiefgreifend verändert – und vielfach nicht zum besseren. Da schaut man kurz hin, konsumiert schnell – und vergißt noch schneller. Erinnern oder Wiederfinden fällt trotz Googles Hilfe schwer, und schon lockt der nächste Link und verspricht noch mehr Information, von der dann noch weniger haften bleibt. Höchste Zeit, sich an die Wiederentdeckung der Gutenberg-Kultur zu machen, in der „Zeit“-Schriften mit ihrer Mischung von Aktualität und Dauerhaftigkeit von Anfang an eine wichtige Rolle spielen.
Womit wir wieder glücklich bei der Una-Voce-Korrespondenz wären, deren aktuelle Ausgabe neben den üblichen über den Tag hinaus aufbewahrenswerten Kurzberichten drei inhaltliche Schwerpunkte hat. Heinz-Lothar Barth beginnt mit einer Darstellung der Bedeutung, die die lateinische Sprache bzw. die in dieser Sprache überlieferten Texte für Lehre und Kultur der westlichen Gesellschaft insgesamt, vor allem aber für die Kirche, haben. Das die vorliegende Ausgabe nur den ersten Teil dieser Ausführungen enthält, werden wir auf die Inhalte erst dann eingehen, wenn der Text komplett vorliegt.
Die beiden anderen Hauptaufsätze behandeln Themen, die gerade in der gegenwärtigen Situation von Kirche und Gesellschaft von großer Bedeutung sind – in der aktuellen Diskussion nicht nur in der katholischen Tradition aber leicht übersehen werden.
Das eine ist die Frage des Zusammenhanges zwischen dem zweiten Vatikanischen Konzil der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und den nach 1968 einsetzenden revolutionären gesellschaftlichen Veränderungen, die Peter Kwasniewski in seinem Aufsatz „Das II. Vatikanum als Ursache einer Kulturrevolution“ behandelt. Die Überschrift formuliert bewußt provokativ: Natürlich hatte die „Große proletarische Kulturrevolution“ in China (1966 – 1976) nicht das zweite Vatikanum als Ursache – aber daß die von dort ausgehenden Erschütterungen mit der „68er-Bewegung“ in den westlichen Industriestaaten so große Resonanz finden konnten und diese Gesellschaften seitdem buchstäblich alles, was zuvor für wahr, schön und gut gehalten worden war, verworfen und in ihr Gegenteil verkehrt haben, wäre ohne die „Vorarbeiten“ des II. Vatikanums nicht erklärbar.
Kwasniewski schreibt dazu: Die beiden stabilsten Bereiche des Gesellschaftlichen Lebens, in denen Veränderungen unter normalen Umständen, langsamsten und am wenigsten auffälligsten ablaufenden, sind die Formen des Gottesdienstes und das Verhältnis zwischen den Geschlechtern“. Beides war vom Konzil und seinen Nachwirkungen – wenn auch zunächst in unterschiedlichem Ausmaß – betroffen: Zunächst hat die verhängnisvolle Liturgiereform die geradezu als Naturkonstante angesehene Selbstverständlichkeit des Gottesdienstes erschüttert – nicht nur in der katholischen Kirche, sondern in praktisch allen christlichen Gemeinschaften des Westens. Inzwischen hat diese Verwirrung auch die andere „Naturkonstante“ des Geschlechterverhältnisses erreicht. Hier scheint die katholische Kirche zwar derzeit noch eine Defensivposition einzunehmen, doch die Voraussetzungen dafür, diese Position auch dauerhaft verteidigen zu können sind durch die Erschütterungen im ersten Bereich untergraben.
Kwasniewski weiter: „Wenn eine Dreizehnjährige nicht weiß, ob sie zu einem Mann oder einer Frau heranwächst, mag das zum Teil auch darauf zurückzuführen sein, daß ihr Priester unter einer ähnlichen Verwirrung hinsichtlich der Voraussetzungen leidet, die für den Empfang seiner Weihe gelten – der Voraussetzung für die liturgische Repräsentation von Christus dem Bräutigam, die doch letztlich für alle gellten, die im Allerheiligsten amtieren. Wenn der Priester verwirrt ist kommt das daher, daß die Institution, der er angehört, sich der Abkehr von der Tradition und dem Experiment geöffnet hat und einer umfassenden Verwirrung anheim gefallen ist, die tief in das Bewußtsein aller Gläubigen eingedrungen ist.“
Eine der wichtigsten Schlußfolgerungen, die Kwasnieski aus diesem und ähnlichen Befunden zieht, muß den wenigen noch lebenden Betreibern der Reformkatastrophe des Konzils und ihren vielen heute noch überaus aktiven Nachplapperern schrill in den Ohren klingen: „ Die Kirchenführer der Jahre 1958 bis 1968 waren keine armen getäuschten Opfer, sondern müssen eher als die Urheber oder Antreiber jenes kulturellen Umsturzes angesehen werden, der dann schließlich 1968 voll ausbrach und dessen Zerstörungswerk seitdem anhält.“
Der andere hier vorzustellende Schwerpunktartikel der Ausgabe 2024-1 ist das dort wiedergegebene Gespräch von Angela Kirsch mit dem Hamburger Pfarrer Oliver Dembski mit der Überschrift: Die neue Messe als Opfer, um die alte Messe feiern zu können.“ Der aus dem Gespräch entstandene Artikel erklärt (unter anderem) genau das, was diese Überschrift anspricht: Für Priester im Dienste eines Bistums erfordert die Feier der überlieferten Liturgie viele persönliche Opfer und die Bereitschaft zu Gratwanderungen, die manchen vielleicht als unerträgliche Kompromisse erscheinen mögen.
Im Praktischen, so kann man aus den Ausführungen von Pfr. Dembski lernen, sind diese Kompromisse manchmal möglich. Man muß nicht in einer Gemeinde, in der der Einfluß von „OutInChurch“-Aktivisten groß ist, mit einer Kapuzinerpredigt zur Verteidigung der überlieferten Sexualmoral antreten – das überzeugt dort nicht nur niemanden, schafft nur böses Blut und schränkt die ohnehin schon geringen Möglichkeiten zur Verteidigung der Lehre weiter ein. Ähnlich steht es um die Bereitschaft zur Austeilung der Kommunion auf die Hand in der sonntäglich im Novus Ordo zu feiernden Gemeindemesse: Dembski ist sich sehr wohl dessen bewußt, welche fehlgeleitete Glaubensvorstellung sich für viele mit diesem Element des Ritus verbindet, aber: Wenn ich mich wehren und sagen würde, ich möchte nicht die Handkommunion austeilen oder generell keine Neue Messe mehr lesen, dann wäre das für den Bischof ein Grund, mich zu suspendieren o.ä. Ich würde damit sicher mein offizielles Apostolat für den alten Ritus (jeden Sonntagnachmittag eine öffentliche Messe nach den Büchern von 1962) verlieren.“
Eine derartige Situation, ein solches Taktieren, mag manche Bewohner von Tradiland zunächst ratlos oder vielleicht sogar beunruhigt zurücklassen dürfte. Dembski selbst macht keinen Hehl daraus, daß er selbst in vielem ratlos und beunruhigt ist. Mehrfach betont er in dem Gespräch, ohne diesen Ausdruck zu benutzen, daß er sich nicht als „Biritualisten“ sieht, der die beiden liturgischen Formen vor und nach 1962 gleicherweise und gleichberechtigt als Ausdruck der lex credendi des katholischen Glaubens sieht. Dafür sind die Defizite der Neuen Form seiner Ansicht nach zu groß, öffnet sie zu viele Schlupflöcher, durch die heterodoxe Ansichten in die ohnehin ständig kleiner werdende Zahl der Gottesdienstbesucher gelangen.
Für diese Überzeugung zahlt er einen hohen Preis: „Also, mit den meisten Priestern meiner Diözese habe ich recht wenig Kontakt, Die wissen natürlich alle, was ich so mache und wie ich denke. Die meisten finden das irgendwie merkwürdig, komisch. Aber ich habe nicht so viel Kontakt, ich besuche auch in der Regel keine Bistumsveranstaltungen. Da müßte ich vorher vermutlich recht viel Alkohol trinken, um das zu ertragen…“
Wie in Traditionis Custodes behauptet, sieht er schwer überwindbare Widersprüche zwischen der überlieferten und der „reformierten“ Form der Liturgie – nur daß er sich doch sehr eindeutig für die ältere ausspricht: Meines Erachtens kann man nur in einer der beiden Welten theologisch und liturgisch daheim sein und die andere Seite dann eben als Randständiger, Außenstehender erleben. Ich habe auch nie an die sogenannte „Hermeneutik der Kontinuität“ des verstorbenen letzten Papstes geglaubt, sondern nur den Bruch zwischen vor- und nachkonziliarer Kirche gesehen.“
Endgültig ratifiziert wird dieser Bruch nach Dembskis Ansicht mit dem deutschen Synodalen Weg, der ihm geeignet erscheint, auch noch die letzten gläubigen Katholiken aus der offiziellen Kirche zu vertreiben. Wie es dann weitergehen soll, für diese Gläubigen, aber auch für ihn selbst, mag er sich nicht vorstellen. Eine „Selbständigkeit“, wie sie vielfach bei altrituellen „Independents“ in den USA praktiziert wird, erscheint ihm nicht als gangbarer Ausweg – die Lehr- und Schlüsselgewalt eines selbständigen Gemeindeträgers ist in seinen Augen ebenso fehlbar und mibrauchsanfällig wie die der offiziellen Hierarchie. Auch der Weg, die Gläubigen durch die Übernahme traditioneller Formen in die Zelebration nach den neuen Büchern zu übernehmen, um ihnen die Augen für diese Formen, die eben auch auf Inhalt e hinweisen, zu öffnen (eine Art „Reform der Reform“ also) erscheint ihm kaum aussichtsreich.
Es sind viele beunruhigende Fragen, die Angela Kirsch und Pfr. Oliver Dembski da in diesem Gespräch anspricht – beunruhigend vor allem deshalb, weil sie darauf verzichten, dafür vermeintlich einfache Antworten und Lösungsrezepte ins Gespräch zu bringen. Und gerade deshalb wäre es wichtig, sich intensiver mit diesen wegen ihrer Unbequemlichkeit oft an den Rand geschobenen Fragen zu befassen.
Dazu gibt diese Ausgabe der UVK wieder einmal allen Anlaß - und das nicht zuletzt in den aktuellen Dokumenten und Miszellen, die diese Nummer wie üblich abrunden.
*